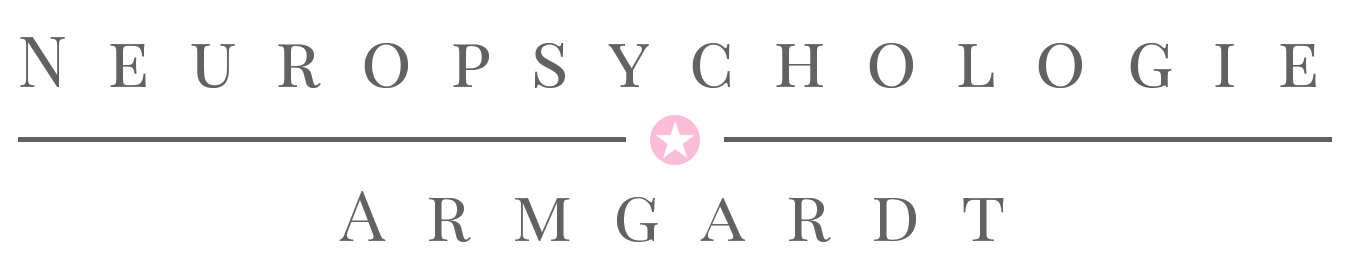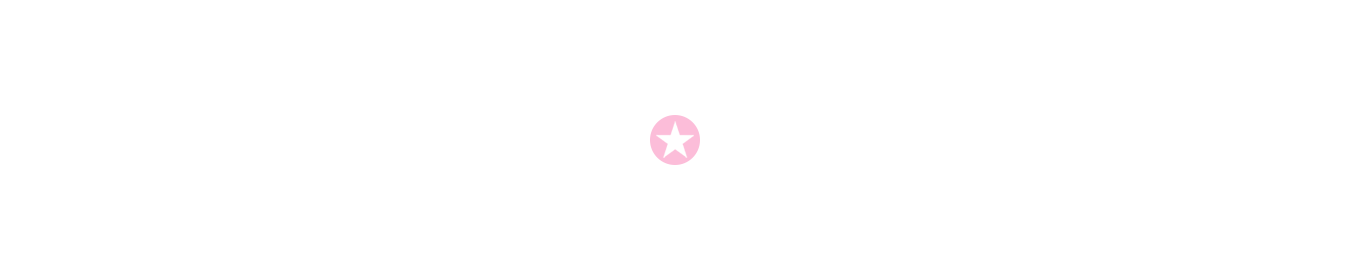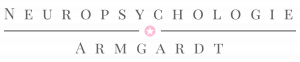Was sich im Kopf verändert – und wie es sich im Alltag zeigt
Ein Schädelhirntrauma (SHT) kann das Leben plötzlich verändern – sei es durch einen Unfall, einen Sturz oder eine Gewalteinwirkung. Die sichtbaren körperlichen Verletzungen heilen oft schneller als die „unsichtbaren“ kognitiven Folgen. Dabei sind gerade diese Beeinträchtigungen für Betroffene und Angehörige häufig schwer greifbar.
Was ist ein Schädelhirntrauma überhaupt?
Ein SHT bezeichnet eine Verletzung des Gehirns infolge einer äußeren Gewalteinwirkung. Je nach Schweregrad (leicht, mittelschwer oder schwer) können unterschiedliche Hirnareale betroffen sein – mit entsprechenden Auswirkungen auf Denken, Fühlen und Verhalten.
Typische kognitive und psychische Folgen
Je nach Lokalisation und Schweregrad treten häufig folgende Beeinträchtigungen auf:
Aufmerksamkeitsstörungen
– Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren
– Ablenkbarkeit, z. B. bei Gesprächen oder in Geräuschkulissen
– Probleme beim Wechseln zwischen Aufgaben (multitasking)
Gedächtnisprobleme
– Neu gelernte Informationen werden schlecht behalten
– Wiederholungen werden nicht als solche erkannt
– Probleme beim Abrufen von Begriffen oder Namen
Exekutive Funktionsstörungen
– Schwierigkeiten beim Planen, Organisieren, Strukturieren
– Unüberlegtes oder impulsives Verhalten
– Langsames Reagieren oder Schwierigkeiten bei Entscheidungen
Verlangsamung der Informationsverarbeitung
– Betroffene brauchen mehr Zeit, um Dinge zu erfassen oder zu antworten
– „Der Kopf fühlt sich zäh an“
Verhaltensveränderungen und Affektregulation
– Reizbarkeit, emotionale Labilität
– Rückzug, depressive Verstimmungen
– Selbstüberschätzung oder fehlende Krankheitseinsicht
Fallbeispiel: Herr L., 42 Jahre, nach Fahrradunfall
Herr L. war früher Projektleiter in einer großen Firma, sportlich aktiv, organisiert, kommunikativ. Nach einem Fahrradunfall mit kurzzeitiger Bewusstlosigkeit wurde ein mittelschweres SHT diagnostiziert. Körperlich erholte er sich schnell – doch die Schwierigkeiten begannen im Alltag.
Typische Beobachtungen:
- Vergesslichkeit: Termine wurden nicht mehr eingehalten, Einkäufe blieben unvollständig
- Verlangsamung: Gespräche fielen ihm schwer, er brauchte viel Zeit zum Antworten
- Impulsivität: Reagierte im Straßenverkehr plötzlich unkontrolliert oder aggressiv
- Strukturprobleme: Verlor im Alltag den Überblick, Aufgaben wurden mehrfach begonnen und nie fertiggestellt
- Frustration: „Ich funktioniere nicht mehr wie vorher“ – depressive Verstimmung, sozialer Rückzug
In der neuropsychologischen Diagnostik zeigten sich deutliche Defizite in der geteilten Aufmerksamkeit, im Arbeitsgedächtnis und in exekutiven Funktionen – typisch für Schädigungen im Frontalbereich.
Was hilft?
Strukturhilfen im Alltag
→ Kalender, Checklisten, feste Tagesstruktur, Reminder-Apps
→ Schritt-für-Schritt-Anleitungen bei komplexeren Aufgaben
Neuropsychologische Therapie
→ Kognitives Training (z. B. Aufmerksamkeit, Gedächtnis)
→ Alltagstraining und Strategievermittlung
→ Psychoedukation – um Verständnis für eigene Defizite zu entwickeln
Unterstützung des sozialen Umfelds
→ Einbindung der Familie in Therapie und Planung
→ Entlastung der Angehörigen durch Aufklärung und Beratung
Ein Schädelhirntrauma betrifft weit mehr als nur das Gehirn – es betrifft das Leben. Die kognitiven und psychischen Folgen sind individuell verschieden, aber keineswegs selten. Mit frühzeitiger Diagnostik, Geduld und gezielter neuropsychologischer Unterstützung kann jedoch vieles wieder erarbeitet und stabilisiert werden.
Der Weg ist oft lang – aber er lohnt sich!