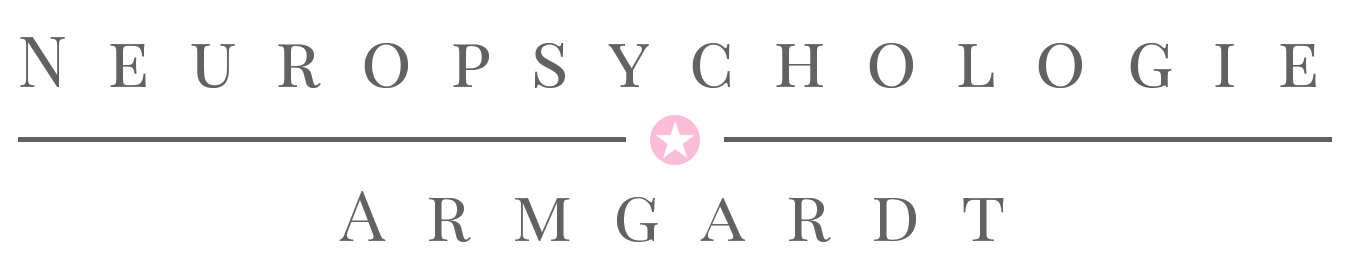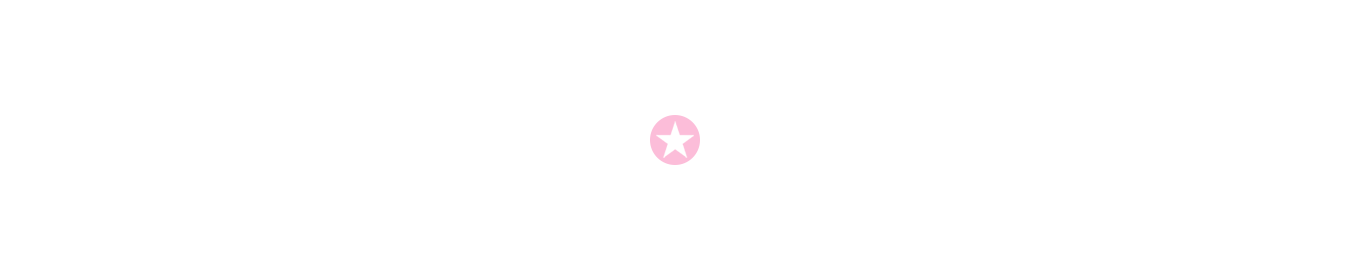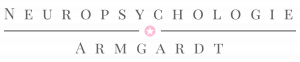Die aktuelle Bildungsstudie (IQB-Bildungstrend 2024) zeigt ein alarmierendes Bild: Bremer Schülerinnen und Schüler schneiden im bundesweiten Vergleich von Schulleistungen erneut am schlechtesten ab. Besonders in den Bereichen Lesen, Mathematik und Orthografie liegen die Ergebnisse deutlich unter dem Durchschnitt. Fast ein Drittel der Viertklässler verfehlt die Mindeststandards in zentralen Kompetenzfeldern – das bedeutet, dass viele Kinder am Ende der Grundschule nicht ausreichend vorbereitet sind, um in der weiterführenden Schule erfolgreich zu lernen.
Diese Zahlen sind keine bloße Statistik. Sie sind Ausdruck einer Entwicklung, die tiefer geht – und Fragen nach den gesellschaftlichen, psychologischen und neurobiologischen Hintergründen aufwirft.
Was steckt dahinter?
Soziale Ungleichheit und Armut – Bremen hat deutschlandweit mit die höchsten Quoten an Kinderarmut. Kinder, die in prekären Lebensverhältnissen aufwachsen, erleben häufiger Stress, Unsicherheit und Überforderung. Diese Faktoren beeinträchtigen die Entwicklung von Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Konzentration erheblich.
Fehlende Stabilität im Bildungssystem – Lehrermangel, hohe Fluktuation und überlastete Schulen erschweren verlässliche Lernbeziehungen. Doch genau diese Beziehungen sind entscheidend für Motivation, Selbstwirksamkeit und emotionale Sicherheit.
Digitalisierung ohne klare Struktur – Der technologische Fortschritt ist in vielen Schulen angekommen, aber oft fehlt es an pädagogischer Einbettung. Tablets ersetzen keine pädagogische Beziehung. Medienkompetenz entsteht durch Anleitung, Reflexion und Grenzen.
Psychische Belastung – Immer mehr Kinder zeigen Erschöpfung, Ängste oder Konzentrationsprobleme. Die Pandemie hat diese Tendenzen verstärkt, aber nicht verursacht – sie hat sie lediglich sichtbarer gemacht.
Neuropsychologisch betrachtet
Chronischer Stress ist kein „weiches“ Thema, sondern ein messbares neurobiologisches Phänomen. Wenn Kinder dauerhaft Belastungen ausgesetzt sind – etwa durch instabile Lebensbedingungen, familiäre Konflikte oder hohen Leistungsdruck – reagiert ihr Gehirn darauf. Der Körper schüttet vermehrt Stresshormone wie Cortisol aus. Kurzfristig steigert das die Wachsamkeit, langfristig jedoch stört es die neuronale Entwicklung.
Besonders betroffen ist der Hippocampus, eine Hirnregion, die für Lernen, Gedächtnis und räumliche Orientierung zuständig ist. Chronisch erhöhte Cortisolspiegel können dazu führen, dass das Hippocampus-Volumen schrumpft, was das Speichern neuer Informationen erschwert. Auch der präfrontale Cortex, der für Konzentration, Planung und emotionale Regulation verantwortlich ist, leidet unter Dauerstress.
Kinder, die sich im sogenannten „Überlebensmodus“ befinden, haben weniger kognitive Kapazität, um schulisch zu lernen und gute Schulleistungen zu erbringen. Ihr Gehirn ist darauf ausgerichtet, Bedrohung zu erkennen und Sicherheit wiederherzustellen – nicht darauf, Wissen aufzunehmen. Erst wenn Sicherheit, emotionale Unterstützung und stabile Strukturen gewährleistet sind, kann sich das volle Lernpotenzial entfalten.
Hier zeigt sich auch, wie wichtig Resilienz ist – also die Fähigkeit, trotz Belastungen stabil zu bleiben und sich psychisch zu erholen. Resilienz entsteht nicht zufällig, sondern durch förderliche Beziehungen, ein unterstützendes Umfeld und das Erleben von Selbstwirksamkeit. Schulen können hier einen entscheidenden Beitrag leisten, indem sie Kinder nicht nur kognitiv, sondern auch emotional stärken.
Was jetzt wichtig wäre – (meine Meinung)
Bremen braucht keine neuen Schuldzuweisungen, sondern nachhaltige Investitionen in Beziehungsarbeit, frühkindliche Förderung, psychische Gesundheit und pädagogische Qualität. Schulen müssen Orte werden, an denen Kinder sich sicher und gesehen fühlen. Nur dann können Lernprozesse wirksam greifen und Schulleistungen verbessert werden.
Lehrkräfte benötigen Unterstützung, um emotionale und kognitive Förderung miteinander zu verbinden – und die Freiheit, Unterricht so zu gestalten, dass er Kindern Sicherheit und Sinn vermittelt.
Und ein positiver Blick nach vorn
Trotz aller Herausforderungen gibt es Hoffnung. Viele engagierte Lehrkräfte, Sozialarbeiter:innen und Therapeut:innen setzen sich täglich dafür ein, dass Lernen wieder Freude macht.
Wenn Schulen Räume werden, in denen Kinder Resilienz entwickeln, digitale Medien bewusst und kreativ nutzen und dabei emotionale Sicherheit erfahren, kann Lernen wieder gelingen. Vielleicht ist Bremen damit gar kein Schlusslicht, sondern der Anfang einer neuen Lernkultur – einer, die psychische Gesundheit, soziale Gerechtigkeit und moderne Pädagogik endlich gemeinsam denkt.
Wenn Sie mehr über meine Arbeit in der klinischen Neuropsychologie und zu Themen wie Lernen, Stress und Resilienz erfahren möchten, finden Sie weitere Beiträge und Informationen auf meiner Homepage: www.neuropsychologie-bremen.de